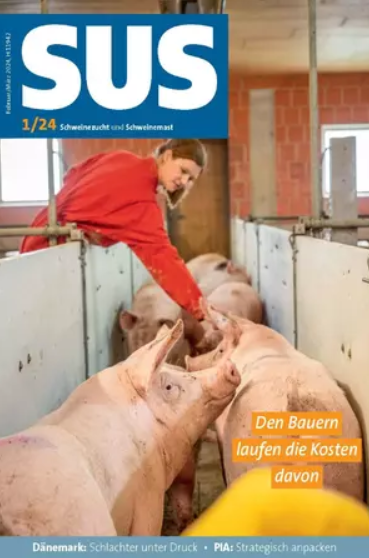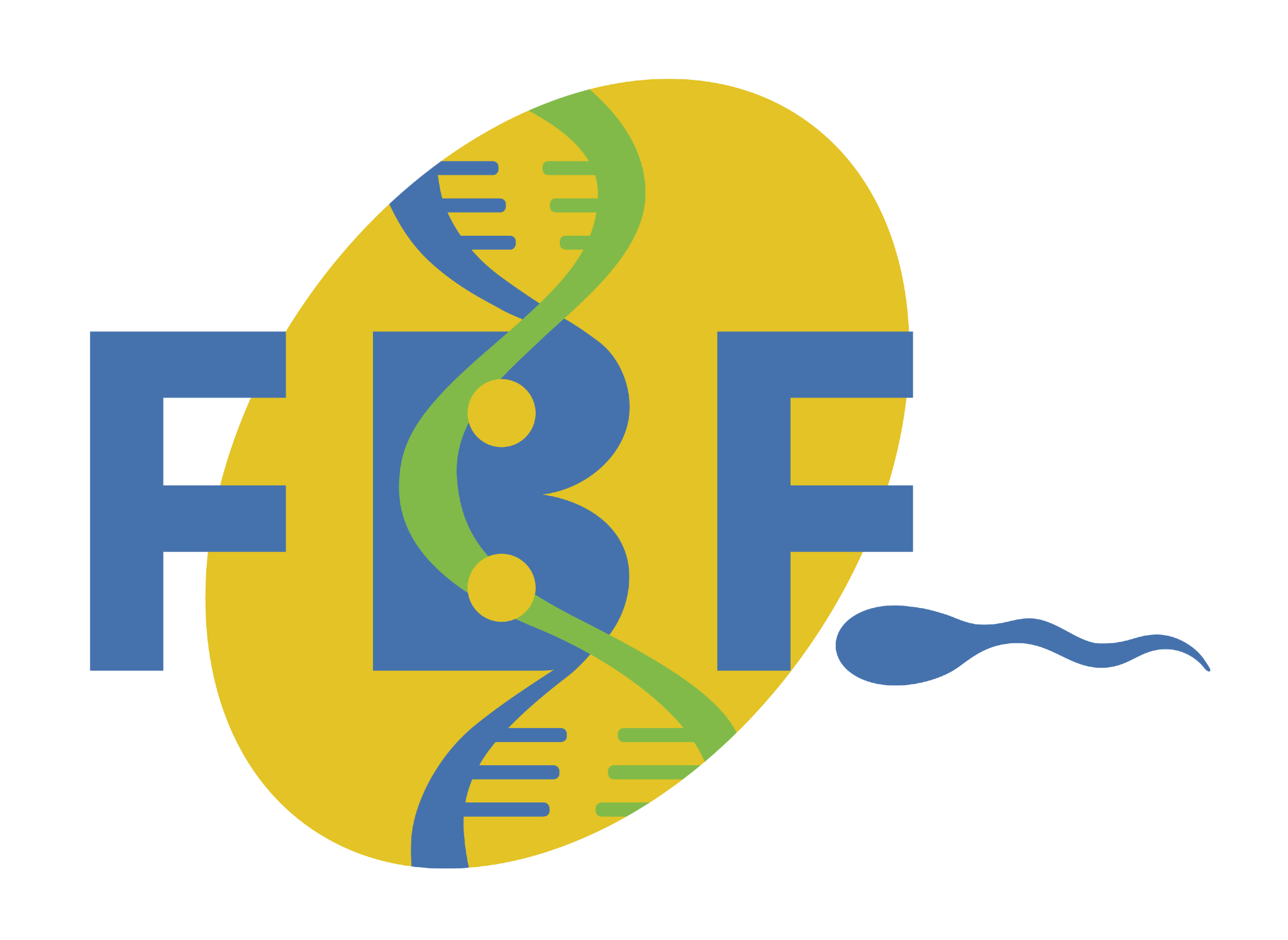Rückforderung von Corona-Hilfen: Schweinehalter unter Druck – was betroffene Landwirte jetzt wissen müssen
Einige landwirtschaftliche Betriebe – insbesondere aus der Schweinehaltung – sehen sich derzeit mit Rückforderungsbescheiden für während der Corona-Pandemie erhaltene Hilfen konfrontiert. In einzelnen Fällen geht es um Rückzahlungen von bis zu 100.000 Euro. Die Forderungen kommen meist überraschend, teilweise Jahre nach der ursprünglichen Auszahlung.
Warum kommt es jetzt zu Rückforderungen?
Während der COVID-19-Pandemie stellten Bund und Länder Soforthilfen zur Verfügung, um Betriebe mit pandemiebedingten Umsatzeinbrüchen zu unterstützen. Nun überprüfen die zuständigen Behörden die Angaben aus den damaligen Anträgen rückwirkend – zum Teil mit strengerer Auslegung der Voraussetzungen als ursprünglich kommuniziert.
Wird bei der Prüfung festgestellt, dass die wirtschaftlichen Einbußen als nicht ausreichend eingestuft werden oder Angaben nicht als korrekt gewertet werden, folgen Rückforderungsbescheide – oft ohne dass sich die aktuelle betriebliche Lage wesentlich verändert hat.
Nicht jede Rückforderung ist rechtens
Landwirte sollten wissen: Eine Rückforderung ist nicht automatisch rechtmäßig. Gerade in der Landwirtschaft, wo Schwankungen durch saisonale oder marktbedingte Faktoren normal sind, kommt es häufig auf eine genaue Einzelfallprüfung an. Häufige Ansatzpunkte für einen erfolgreichen Widerspruch oder eine Klage sind unter anderem:
-
korrekte und gutgläubige Angaben bei Antragstellung,
-
Schutz des berechtigten Vertrauens in die Bewilligung,
-
lange Untätigkeit der Behörde (Verwirkung),
-
formelle Fehler im Rückforderungsbescheid.
Fristen sind entscheidend
Ein Widerspruch gegen den Bescheid ist in der Regel nur innerhalb eines Monats möglich. Wer diese Frist versäumt, kann sich später in der Regel nicht mehr dagegen wehren. Betroffene sollten daher zeitnah prüfen lassen, ob ein Vorgehen gegen die Rückforderung Erfolg verspricht.