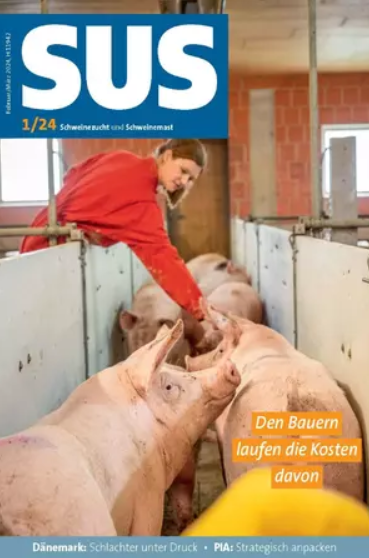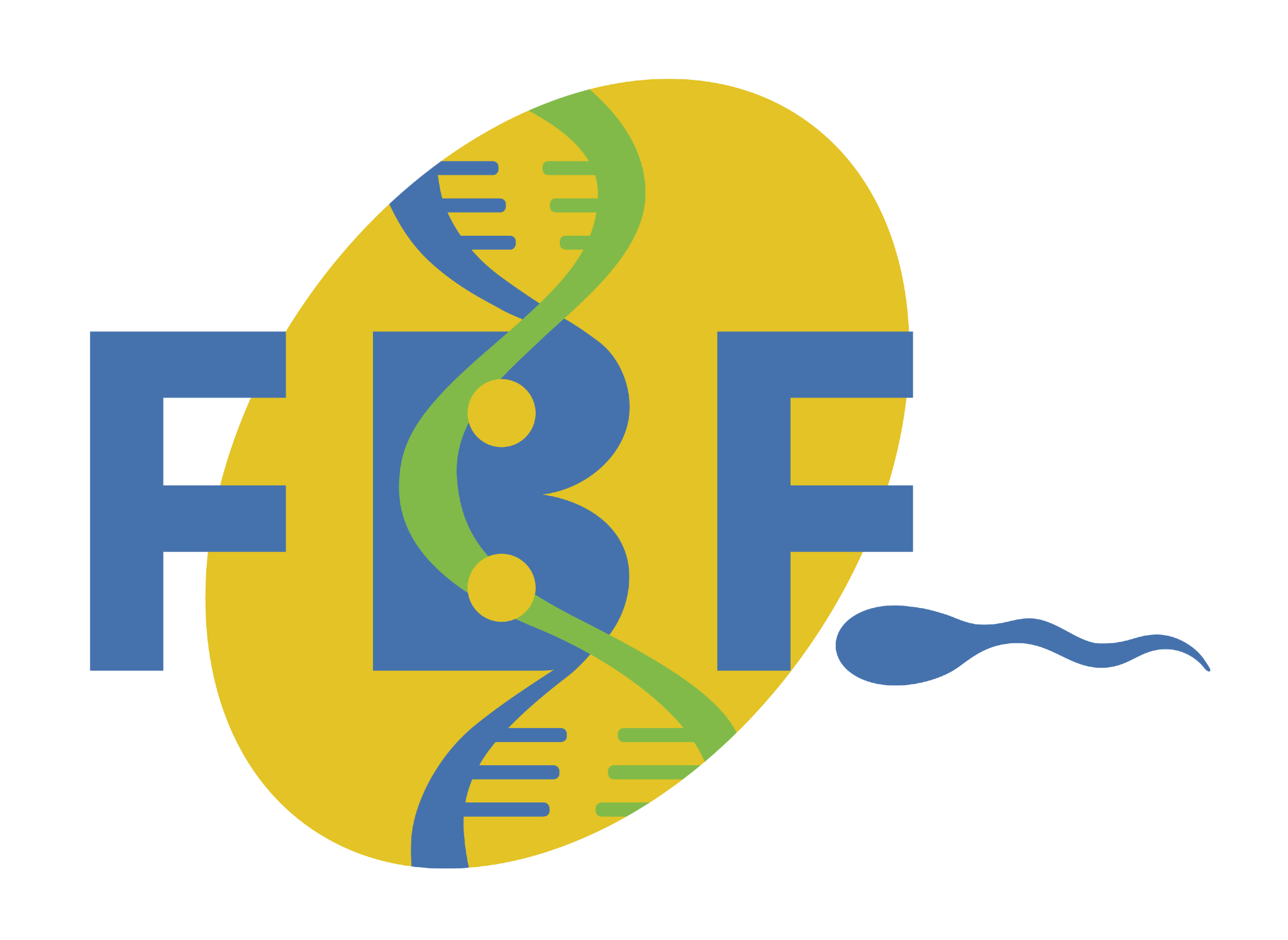Informationsportal Afrikanische Schweinepest
Am 10. September 2020 wurde in Brandenburg bei einem Wildschwein-Kadaver wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Landkreis Spree-Neiße das Virus der Afrikanische Schweinepest (ASP) amtlich nachgewiesen. Es handelte sich um den ersten Fall von ASP in Deutschland. Im Laufe des Jahres 2020 wurden weitere Fälle in Brandenburg und in angrenzenden Bundesländern festgestellt. 2021 und 2022 traten die Ausbrüche weiterhin vor allem in Ostdeutschland auf, insbesondere in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Am 15.06.2024 wurde das ASP-Virus dann zum ersten Mal bei einem Wildschwein in Hessen nachgewiesen und am 09.07.2024 trat der erste Fall von ASP bei einem Wildschwein in Rheinland-Pfalz auf. Seit dem 08.08.2024 ist Baden-Württemberg und seit dem 15.06.2025 auch Nordrhein-Westfalen von der ASP betroffen.
Die zuständigen Behörden haben Maßnahmen ergriffen, um eine Weiterverbreitung der Seuche zu verhindern. Die Vorgehensweise richtet sich nach den Vorgaben der nationalen Schweinepest-Verordnung auf Grundlage von EU-Gesetzen. Wichtig ist, das Infektionsgeschehen einzugrenzen und in den Betrieben alle Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten, um eine Einschleppung in Hausschweinebeständen zu verhindern. Hinsichtlich der Auflagen für Betriebe, die in den eingerichteten Restriktionsgebieten liegen, sind die von den Behörden der betroffenen Landkreise herausgegebenen Informationen zu beachten. Dies gilt besonders für Beschränkungen beim Viehverkehr und für Vermarktungsveranstaltungen.
Die Tierseuche ist für Menschen ungefährlich. Auch vom Verzehr von gegebenenfalls kontaminierten Fleisch geht keine Gefahr für die Gesundheit aus.


 BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION über die Leitlinien für die Prävention, Bekämpfung und Tilgung der Afrikanischen Schweinepest in der Union ("ASP-Leitlinien")
BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION über die Leitlinien für die Prävention, Bekämpfung und Tilgung der Afrikanischen Schweinepest in der Union ("ASP-Leitlinien")