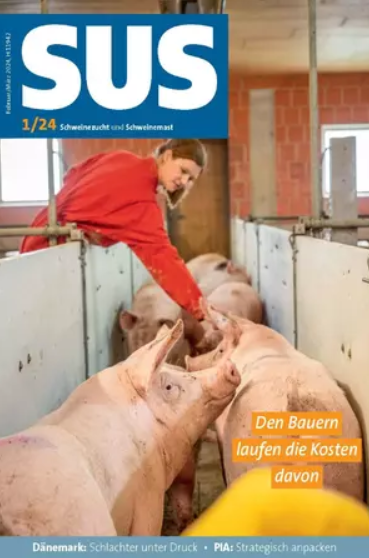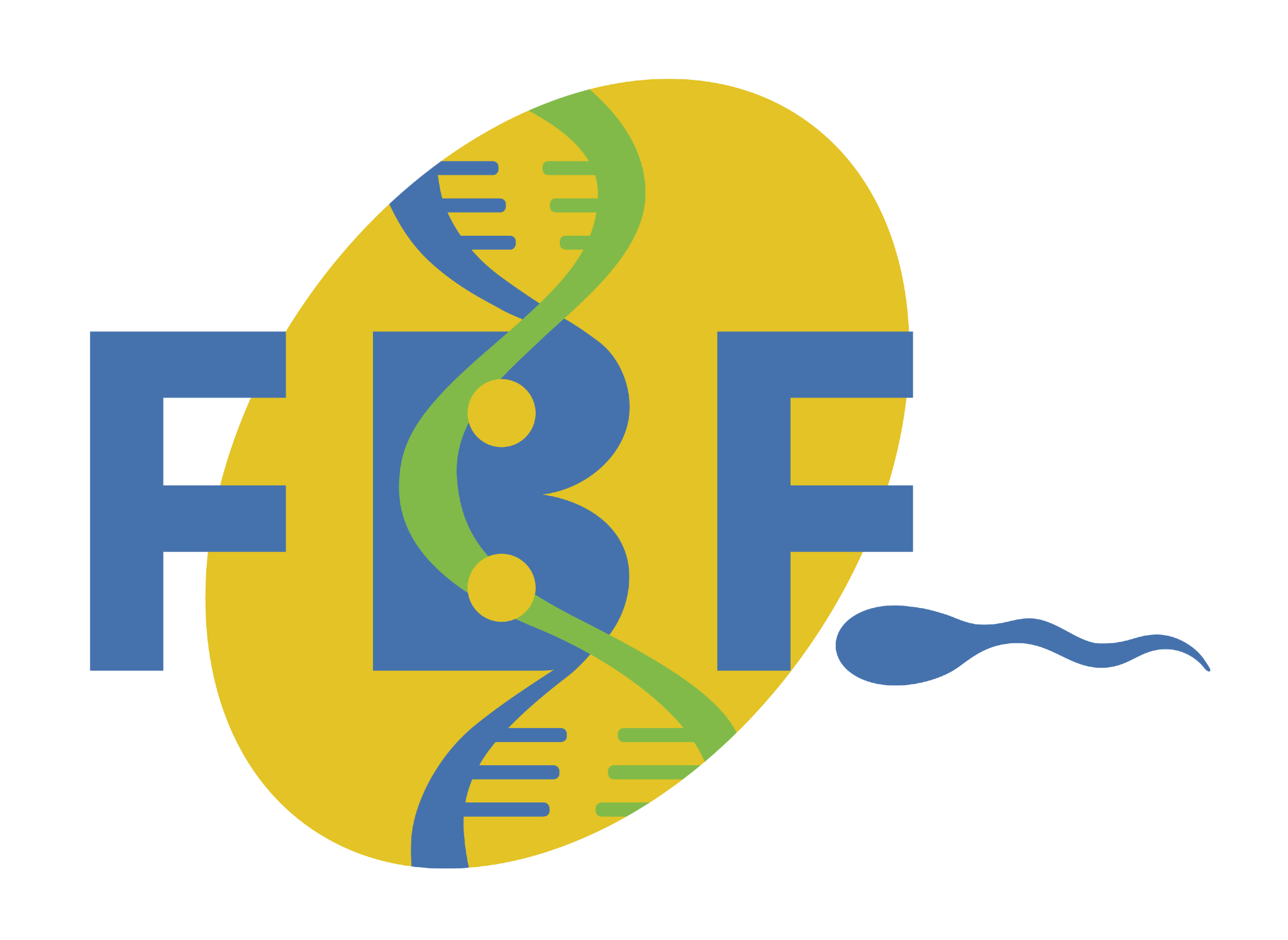BRS News Rind
Weidebetriebe für das Projekt "Verbesserung des Tierwohls bei Weidehaltung von Milchkühen" gesucht
Am 1.1.2021 startete das MuD Tierschutz-Vorhaben Verbesserung des Tierwohls bei Weidehaltung von Milchkühen
mit dem Ziel der Stärkung der Weidehaltung unter Berücksichtung von Tierwohl. Im Fokus: Bestehende Kennzahlen für die Bewertung des Tierwohls von Milchkühen auf weidehaltenden Betrieben und die Entwicklung weiterer Parameter zur Beurteilung des Tierwohls auf der Weide. Für das Projekt werden ab sofort bundesweit innovative und motivierte landwirtschaftliche Weidebetriebe, die als Modell- und Demonstrationsbetrieb (MuD) mitwirken möchten, gesucht.
Veranstaltungen der LWK Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Projektes "Fokus Tierwohl"
Im Rahmen des Netzwerks Fokus Tierwohl, einem Verbundprojekt, das den Wissenstransfer in die Praxis verbessern soll, um schweine-, geflügel- und rinderhaltende Betriebe in Deutschland hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen, finden in 2021 verschiedene Veranstaltungen zu den einzelnen Tierarten statt. Die Landwirtschaftskammer NRW lädt zu den Online-Veranstaltungen "Bedarfsgerechte Wasserversorgung bei Rindern" am 27.01. sowie "Muttergebundene Kälberaufzucht" am 04.02. für Rinderhalter ein.
BMU-Agrarkongress: Schulze legt konkrete Vorschläge zur Umsetzung der EU-Agrarreform vor
Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat am 13.01. auf dem BMU-Agrarkongress konkrete Vorschläge vorgelegt, wie Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland gezielt für wertvolle Leistungen zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz honoriert werden können. Die Vorschläge dienen dazu, die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union ab dem Jahr 2023 in Deutschland umzusetzen. Kern des Vorschlags sind zehn neue Öko-Regelungen
(Eco-Schemes), für die zunächst 30 Prozent der europäischen Direktzahlungen genutzt werden sollen. Die Eco-Schemes
sollen über die EU-Gelder finanzert werden. Mindestens 10 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen sollen für den Artenschutz reserviert und für mehrjährige Brachen, Gewässerrandstreifen oder Landschaftselemente genutzt werden.
Der NRW-Milchmarkt 2020 - viel Corona, aber eben nicht nur
Der Milchmarkt in Nordrhein-Westfalen verzeichnete aufgrund der Corona-Pandemie im Gastronomiebereich Absatzeinbußen von bis zu 75%. Andere Segmente (Trinkmilch, Quark) konnten zeitweise zwar profitieren, aber insgesamt die Negativeffekte nicht ausgleichen. Der Export als wichtiger Faktor des Marktes stand ebenfalls unter Druck. Die Molkereien und Milcherzeuger mussten, wie alle Wirtschaftsbeteiligten, erhebliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung eines Corona-Ausbruchs etablieren und Prozesse anpassen. Dies sei der Milchbranche bislang sehr gut gelungen, so Geschäftsführer Dr. Rudolf Schmidt in der ersten digitalen Jahrespressekonferenz der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e.V. (LV Milch NRW) am 13.01.2021.
Globaler Preisindex für Milch und Fleisch 2020 gefallen
Die Welternährungsorganisation (FAO) ermittelt regelmäßig den Lebensmittelpreisindex als Maß für die Veränderungen der internationalen Nahrungsmittelpreise. Demnach lag der FAO-Milchpreisindex für das Gesamtjahr 2020 bei durchschnittlich 101,8 Punkten und damit um 1,0 Punkte (1,0 Prozent) niedriger als 2019. Der FAO-Fleischpreisindex lag bei durchschnittlich 95,5 Punkten und damit 4,5 Punkte (4,5 Prozent) niedriger als 2019. Über die verschiedenen Fleischkategorien hinweg verzeichneten die Preise für Geflügelfleisch den größten Rückgang, gefolgt von denen für Schaf-, Schweine- und Rinderfleisch.
Emissionen seit 1990 um 24 % gesunken
Seit 1990, dem Bezugsjahr des ersten Klimaschutzabkommens, des Kyoto-Protokolls, hat die deutsche Landwirtschaft die Treibhausgasemissionen bereits von rund 89,9 Mio. t CO2-Äquivalent auf 68,2 Mio. t CO2-Äquivalent in 2019 gesenkt. Wie der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) mitteilt, entspricht dies einer Reduzierung der Emissionen um 24%. In 2019 sind die landwirtschaftlichen Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um gut 2% zurückgegangen. Geringere Tierbestände verbunden mit Effizienzsteigerungen in der landwirtschaftlichen Erzeugung haben dazu geführt, dass die Treibhausgasemissionen gesenkt und gleichzeitig die Produktion gesteigert werden konnte. Die Landwirtschaft produziert heute mehr und belastet das Klima dabei deutlich weniger als noch 1990.
Rechtliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Empfehlungen der Borchert-Kommission
Am 12. Januar 2021 diskutierten über 250 Agrarjuristen sowie Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Landwirtschaft und Behörden im Rahmen des 11. Berliner Forums über notwendige zentrale rechtliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Empfehlungen der Borchert-Kommission zum Umbau der Nutztierhaltung zur Etablierung höherer Tierwohlstandards. Die Umsetzung der gesellschaftlichen Ansprüche für mehr Tierwohl kann nur mit den Landwirten bei Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Tierhaltung in Deutschland gelingen. Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung habe in seinem Konzept einen neuen Ansatz entwickelt, um das zu gewährleisten: ein Umbau der Tierhaltung in Verbindung mit einem langfristig gesicherten Ausgleich für höhere Standards im Tier- und Umweltschutz, hob DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken zu Beginn hervor. Der Umbau könne gelingen, wenn das Konzept der Borchert-Kommission in Gänze umgesetzt wird und tragfähige rechtliche Voraussetzungen für die langfristige Finanzierung, eine verbindliche, flächendeckende Kennzeichnungsregelung und vor allem im Bau- und Genehmigungsrecht geschaffen werden. Notwendige Anpassungen im Bau- und Immissionsschutz für Tierwohlställe dürfen nicht durch politische Blockaden verschleppt werden.
Die Voträge des 11. Berliner Forums stehen zum Download zur Verfügung.
Entwicklung eines offenen KI-Standards für die Landwirtschaft
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) spielen eine Schlüsselrolle, wenn es um die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen für die Landwirtschaft geht. Um das enorme Potenzial intelligenter Technologien nutzen zu können, braucht es eine vertrauenswürdige und leistungsfähige IT-Infrastruktur. Auf Initiative des Agrotech Valley Forums arbeitet im Projekt Agri-Gaia ein namhaftes Konsortium aus Industrie und Forschung an der Realisierung eines offenen KI-Standards für die Agrar- und Ernährungswirtschaft auf Basis der europäischen Cloud-Initiative GAIA-X. Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit rund 12 Millionen Euro gefördert.
Hohe Nachfrage im „Investitionsprogramm Landwirtschaft“
Die Nachfrage nach Mitteln aus dem Investitionsprogramm Landwirtschaft
, das die Rentenbank im Auftrag des Bundes umsetzt, ist sehr hoch. Die deutsche Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum informierte über das Programm seit dem 4. Januar 2021 in insgesamt 17 000 Telefonaten, davon allein 12 000 am 11. Januar, dem Tag des Programmstarts. Die für das erste Halbjahr 2021 zur Verfügung stehenden Bundesmittel sind für Teilbereiche des Programms bereits ausgeschöpft: Zuschussanträge für den Kauf von Maschinen können erst ab dem zweiten Halbjahr 2021 wieder gestellt werden. Der Bund stellt im Investitionsprogramm Landwirtschaft
bis 2024 insgesamt 816 Mio. Euro an Zuschüssen für eine umwelt- und klimaschonende Landwirtschaft bereit. Die Mittel werden halbjährlich in drei Plafonds bereitgestellt. Im ersten Halbjahr 2021 stehen für Maschinen 72,5 Mio. Euro, für Lagerstättenerweiterungen für Wirtschaftsdünger 26 Mio. Euro und für Gülleseparierung 5 Mio. Euro zur Verfügung. Eingegangene Anträge verfallen nicht. Sie werden in den folgenden Halbjahren in der Reihenfolge ihres Eingangs vorrangig berücksichtigt, solange Haushaltsmittel des Bundes zur Verfügung stehen.
Gärrückstände aus Biogasanlagen pflanzenbaulich verwerten
Nährstoffüberschüsse in Veredelungsregionen und die jüngsten Änderungen der Düngeverordnung stellen Biogasanlagenbetreiber und tierhaltende Landwirte vor immer größere Herausforderungen. Im Umgang mit Wirtschaftsdüngern und Gärprodukten steigt deshalb der Bedarf an neuen Lösungen für Aufbereitung, Handling und die bedarfsgerechte Ausbringung. Im Tagungsband der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) zur 4. Fachtagung Pflanzenbauliche Verwertung von Gärrückständen aus Biogasanlagen
präsentieren Experten aus Wissenschaft und Praxis ihre Lösungen und Konzepte, um künftig den steigenden Anforderungen an das Gärresthandling gerecht zu werden, die Nährstoffe im Kreislauf zu halten und nicht längerfristig in den Boden oder in die Luft zu verlagern. Der Tagungsband ist in der Schriftenreihe Gülzower Fachgespräche
erschienen und steht zum Download zur Verfügung.