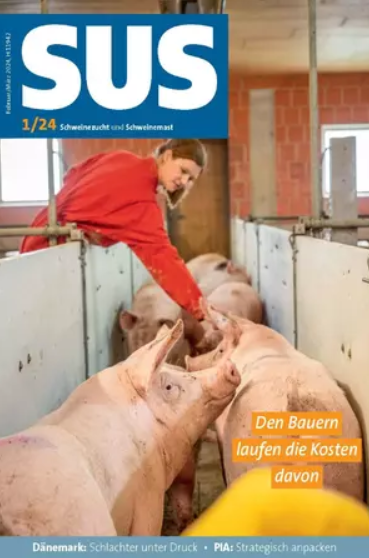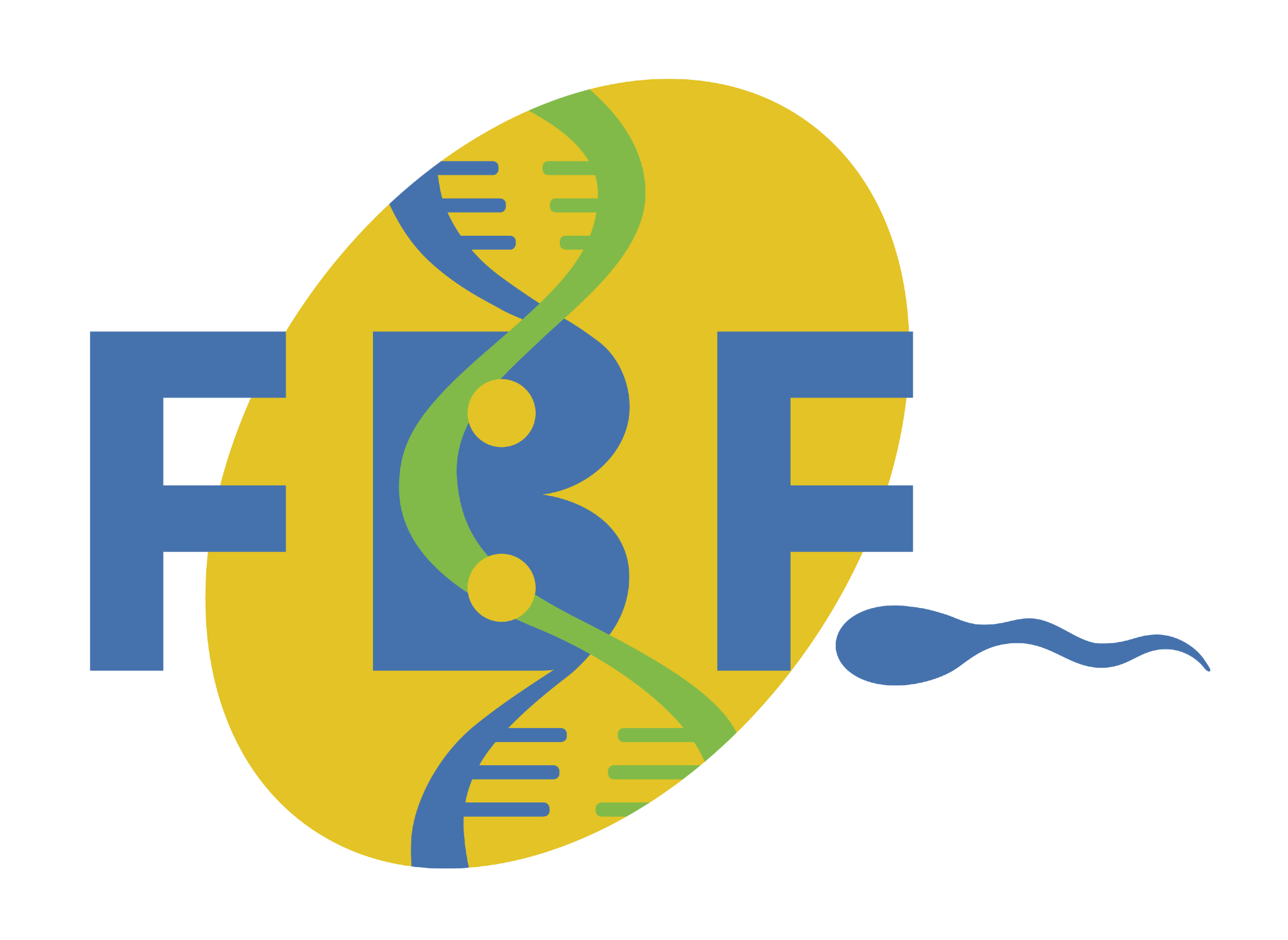BRS News
ÖTK spricht sich strikt gegen geplantes Antibiotikaverbot aus
Reserveantibiotika - sie sollen, wenn es nach dem Umweltausschuss des EU-Parlaments geht, für die Humanmedizin reserviert werden, um Resistenzen vorzubeugen. Derzeit liegt ein Entschließungsantrag unter Federführung des deutschen Grünen Martin Häusling auf dem Tisch, über den nächste Woche im EU-Parlament abgestimmt wird. Darin fordert Häusling die EU-Kommission auf, fünf von insgesamt 35 Wirkstoffen der Reserveantibiotika offiziell in der Tiermedizin zu verbieten.
Die österreichische Tierärztekammer spricht sich strikt gegen die geplanten Regeln aus. Der Antrag beinhaltet schwere Forderungen, die stark über das Ziel hinausschießen
, so Kammerpräsident Kurt Frühwirth zu ORF.at. Es handle sich um ein Verbot per Gießkanne, bei dem zuerst untersagt werde und in späterer Folge wieder Ausnahmen gemacht werden sollen. Wenn es einen Entzug von Antibiotika für die Veterinärmedizin geben soll, dann muss einzeln geprüft und wissenschaftlich bewiesen werden, wieso ein bestimmter Wirkstoff in bestimmten Fällen nicht mehr einzusetzen ist, etwa über einen Kriterienkatalog.
Klares Bekenntnis zur deutschen Schweinehaltung
Ferkelerzeugung und Schweinemast sind wichtige Produktionszweige der heimischen Landwirtschaft – jetzt und in Zukunft. Daher arbeiten Schweinehalter, landwirtschaftliche Marktexperten, Vertreter von Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen sowie Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels im Agrardialog lösungsorientiert an einem Maßnahmenkatalog, der das wirtschaftlich erfolgreiche Arbeiten aller Mitglieder der Wertschöpfungskette ermöglicht.
21. Bauerntag der VzF GmbH: Tierhaltung am Scheideweg - eine Produktion für die Zukunft oder jeder rette sein Kapital

China soll mittlerweile 26 Europäische Schlachtunternehmen für den Export von Fleisch gesperrt haben. In Kombination mit Corona und der Afrikanischen Schweinepest führt dies zu einer desaströsen Marktsituation bei Schweinefleisch. Die Lager sind voll. Der Verein zur Förderung der bäuerlichen Veredelungswirtschaft e.V., die NordLand Zuchtschweine-Erzeugergemeinschaft w.V., die Bauernsiegelferkel-Erzeugergemeinschaft w.V. und die BauernSiegel Erzeugergemeinschaft Elbe-Weser w.V. laden am 15. September 2021 ab 13:30 Uhr zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema "Tierhaltung am Scheideweg - eine Produktion für die Zukunft oder jeder rette sein Kapital!" ein. Veranstaltungsort ist der Niedersachsenhof, Lindhooper Str. 97 in 27283 Verden. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich. Um Anmeldung bis zum 12.09.2021 wird gebeten.
Maissilage in Milchkuhrationen: Worauf kommt es an?
Maissilage ist aus der Rinderfütterung, ob in der Milchkuhhaltung oder der Bullenmast, nicht wegzudenken. In mehr als der Hälfte der Milchkuhrationen ist sie sogar die tragende Säule
mit einem Anteil von mehr als 50 %, bezogen auf die Grobfutterrations-Trockenmasse. Daher stellen die Milchkuhhalter große Erwartungen an Maissorten.
Worauf es dabei ankommt, stellen Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge von der Fachhochschule Kiel und Dr. Wolfram Richardt, Landwirtschaftliche Kommunikations- und Servicegesellschaft mbH, im aktuellen Fachbeitrag vor.
Über ein Viertel aller Besamungen mit Hornlos-Genetik
Im Jahr 2020 hat sich der Gesamtanteil der Hornlos-Besamungen in der deutschen Holsteinzucht um 3,8% auf jetzt 25,6 % gesteigert.
RZ€, neuer RZG, Gesundheitszuchtwerte: Wie nutzen Züchter die neuen Instrumente?
Seit Einführung der direkten Gesundheitszuchtwerte im April 2019 hat die deutsche Holsteinzucht den rein wirtschaftlich gewichteten Gesamtzuchtwert RZ€ eingeführt und den seit Langem bekannten RZG angepasst. Im Gespräch mit jungen Betriebsleitern wollten wir erfahren, wie sie die neuen Instrumente im Rahmen ihrer Zuchtstrategie nutzen.
Der passende Arbeitsplatz für die Klauenpflege
Wie sieht der optimale Klauenpflegestand aus Sicht von Mensch und Tier aus? Das haben wir zwei praktische Tierärzte und Klauenpfleger gefragt: Hubert Reßler und Dr. Peter Klindworth haben geben Tipps für die Planung und den Einsatz der Pflegestände.
Top-Themen in der aktuellen milchrind-Ausgabe
Die neue Ausgabe von milchrindist gedruckt und unterwegs zum Leser. Im Heft finden Sie die Ergebnisse der German Dairy Show digital. Die Präsentation der Schaukühe wird ab 10. September ergänzt durch eine Video-Nachzuchtschau. Außerdem gibt es in der neuen milchrind-Ausgabe einen Beitrag zur Frage, wie der für Mensch und Tier optimale Klauenstand aussieht, ein Update zur Hornloszucht sowie Interviews mit Landwirten zur Nutzung der neuen züchterischen Instrumente. Strategien fürs Fruchtbarkeitsmanagement werden ebenso beleuchtet wie neue Vorschriften zur Unfallverhütung im Milchviehstall. Ein Züchter aus Schleswig-Holstein berichtet über seine Leidenschaft für die roten Angler. Und es gibt alle Infos zur August-Zuchtwertschätzung.
Brasilien lässt Futtermittelzusatz zur Methanreduktion bei Rindern zu
Brasilien, der weltgrößte Rindfleischexporteur, hat den Verkauf eines Futtermittelzusatzes genehmigt, der die Methanemissionen von Rindern verringert, da der Druck auf die Viehwirtschaft wächst, ihre Rolle bei der globalen Erwärmung einzuschränken. Es handelt sich um das Produkt mt dem Markennamen Bovaer
des niederländischen Unternehmens Royal DSM NV. Der Futtermittelzusatzstoff kann bei Rindern und Milchkühen sowie für Schafen und Ziegen verwendet werden. In Chile hat es bereits eine Zulassung.
Fütterungsmanagement und Effizienzsteigerung sind derzeit bewährte Mittel für eine Reduzierung des Treibhausgases. Gute Erfolge versprechen Futterzusatzstoffe aus Algen, die zu Methanreduktionen von 80 Prozent beitragen sollen.
Landwirt für einen Tag: "Mich hat der Tag geerdet und glücklich gemacht"

Politikerin Anne König interessiert sich für die Belange der Landwirtschaft und sprach mit Tobias Honvehlmann auf dessen Hof. Möglich gemacht hat dies das Forum Moderne Landwirtschaft im Rahmen seiner Kampagne Landwirt für einen Tag
. Was die Politikerin dabei erlebte, hat das Forum jetzt im Verbrauchermagazin Stand.Land.Wissen
(Ausgabe 3/2021) veröffentlicht.