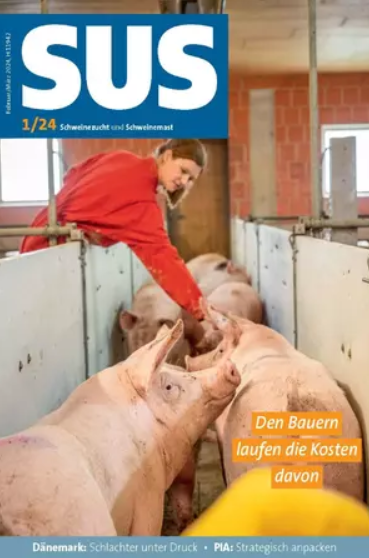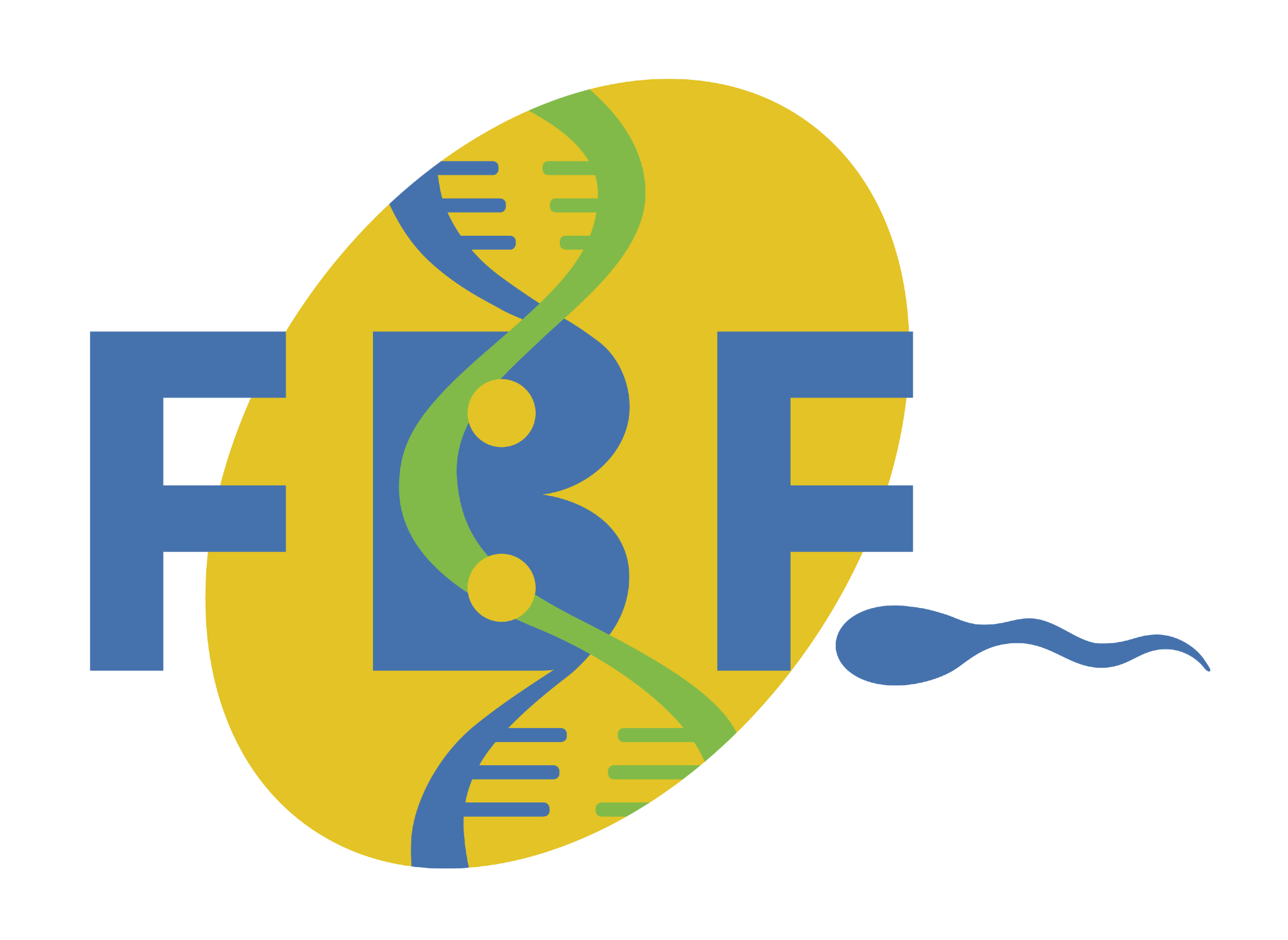BRS News Rind
"Opportunitätskosten" am Beispiel der Biokraftstoffe erklärt
Als Opportunitätskosten bezeichnet man einfach gesagt den entgangenen Nutzen einer nicht gewählten oder nicht realisierbaren Handlungsalternative. Sie zu kalkulieren, wird diese Tage gerne vergessen, wenn es um die Ernährungssicherheit geht. Bei Biokraftstoffen scheint die Situation klar, glaubt man den Ergebnissen einer Studie des ifeu im Auftrag der DUH. Die Einsparung an Treibhausgasemissionen durch den Einsatz von Anbau-Biokraftstoffen anstelle von fossilen Kraftstoffen betrug in 2020 nach amtlichen Angaben 9,2 Mio. t CO2-Äq.. Würde man auf diese Einsparung verzichten und stattdessen auf den für Biokraftstoffe belegten Flächen natürliche Vegetation aufwachsen lassen, wäre dadurch eine mittlere jährliche Kohlenstoffbindung von über 16 Mio. t CO2 möglich.
Was dabei vergessen wird, sind die Vorteile durch Nutzung der Koppelprodukte in der Tierernährung, die u.U. zu Einsparungen von Importsoja führen oder der Einsatz verbotener Pflanzenschutzmittel durch Verlagerung der Produktion in andere Länder. Fairerweise müssten solche Aspekte ebenfalls in Berechnungen der Opportunitätskosten berücksichtigt werden. Die Allokationseffekte (Flächeneinsparung durch Koppelprodukte) werden in der Studie berücksichtigt, nicht aber die Flächeneinsparungen durch Reduktion von Sojaimporten durch verstärkte Nutzung der Koppelprodukte aus regionaler Erzeugung.
Mehr Tierwohl in der Milcherzeugung – Bundeskartellamt toleriert Einführung des QM+-Programms
Das Bundeskartellamt hat keine durchgreifenden kartellrechtlichen Bedenken gegen die Branchenvereinbarung Milch
des QM-Milch e.V. für mehr Tierwohl in der Milcherzeugung. Zentrale Elemente des Programms sind die Einführung eines Labels für Produkte, die die Tierwohl-Kriterien des QM+-Programms erfüllen sowie die Finanzierung der anfallenden Mehrkosten mittels eines sogenannten Tierwohlaufschlages für die Erzeuger. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: Die Vereinbarung der Milchbranche über einen verbindlichen Tierwohlaufschlag kann für die erste Programmphase bis 2024 toleriert werden. Gerade bei der Milch gibt es sehr viele unterschiedliche Konkurrenzlabel und lebhaften Wettbewerb zwischen den verschiedenen Marken. Nur ein Teil der Molkereien wird an dem QM+-Programm teilnehmen. Nach der ersten Phase muss erneut evaluiert werden, inwieweit zusätzliche wettbewerbliche Elemente eingeführt werden können".
Versorgungsbilanz Fleisch 2021: Pro-Kopf-Verzehr sinkt auf 55 Kilogramm
Nach vorläufigen Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) sank der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch im Vergleich zu 2020 um 2,1 Kilogramm und liegt damit auf einem neuen Rekordtief seit Berechnung des Verzehrs 1989. Insgesamt wurde 2021 Fleisch mit einem Schlachtgewicht von 8,3 Millionen Tonnen erzeugt – rund 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Pro-Kopf-Verbrauch sank 2021 im Vergleich zum Vorjahr bei Schweinefleisch um 1,2 Kilogramm und bei Rind- und Kalbfleisch um 600 Gramm. Der abnehmende Verzehr wurde, wie bereits im Jahr zuvor, von einem Importrückgang von Fleisch, Fleischwaren und Konserven aus Schweinen, Rindern und Kälbern begleitet (-6,8 Prozent). Des Weiteren nahm das Außenhandelsvolumen mit lebenden Tieren 2021 erneut ab: Insbesondere die Einfuhr sank über alle Tierarten um fast ein Fünftel (19,6 Prozent), die Ausfuhr reduzierte sich um ein Prozent. Die Tendenzen im Außenhandel wirken sich auf die Nettoerzeugung – der im Inland geschlachteten Tiere – aus: Im Vergleich zu 2020 wurde 2,4 Prozent weniger Schweinefleisch produziert. Bei Rind- und Kalbfleisch sowie bei Geflügel fiel die Nettoerzeugung um 1,6 Prozent. Nach den vorläufigen Zahlen ergibt sich für 2021 insgesamt ein Selbstversorgungsgrad bei Fleisch von 121 Prozent – ein Plus von 2,5 Prozentpunkten. Der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch liegt bei 132,4 Prozent, bei Rind- und Kalbfleisch bei 98,2 Prozent.
DMK Group führt mit MILRAM vegane Produkte ein
Im Rahmen ihrer Strategie 2030 erweitert die DMK Group ihr Sortiment um pflanzliche Produkte. Mit ihrer Marke MILRAM bringt Deutschlands größte Molkereigenossenschaft ab sofort auch vegane Puddings, einen Kakaodrink sowie ein Reisdessert in den Handel. Spätestens zum ersten Quartal des neuen Jahres sollen Produkte in weiteren wichtigen Kategorien folgen.
DBV: Maßnahmen zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung sowie zur Kostendämpfung auf den Weg bringen
Anlässlich der Agrarministerkonferenz fordert der Deutsche Bauernverband in einem Anliegenpapier die Agrarminister der Länder und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir dazu auf, kurz- und langfristige Maßnahmen zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung sowie zur Kostendämpfung auf den Weg zu bringen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, fordert, die von Seiten der EU-Kommission vorgegebenen kurzfristigen Anpassungen bei der Gemeinsamen Agrarpolitik in Deutschland vollständig umzusetzen: Wir müssen das vorhandene Potenzial für die Lebensmittelerzeugung in Europa nutzen, um eine ausreichende Rohstoffverfügbarkeit sicherzustellen.
MX-Konzept von Agravis zur Methanreduktion
Wie die Agravis Raiffeisen AG in einer Pressemeldung mitteilt, bietet das neue MX-Konzept der AGRAVIS Rinder haltenden Betrieben die Möglichkeit, Methanreduktion und maximale Futtereffizienz zu verbindet. Durch die Verwendung einer besondere Rationsgestaltung im Hinblick auf die Methanreduktion unter Berücksichtigung der offiziellen Formel zur Berechnung der Methanproduktion der Kühe soll eine gesteigerte Futtereffizienz so maßgeblich zur Methanreduktion beitragen. Mit dem MX-Konzept haben wir nach unserer Überzeugung eine zukunftsfähige Lösung entwickelt: Wir erreichen momentan je nach Ausgangssituation eine berechnete Methanreduktion von fünf bis maximal zehn Prozent in einer melkenden Herde. Mit unserem Konzept planen wir, bis 2024 eine Reduktion von 30 Prozent erreichen zu können
, berichtet Tierarzt Dr. Bernhard Lingemann aus dem Produktmanagement Rind der AGRAVIS Futtermittel GmbH.
Für gesunde Kälber - die optimale Versorgung mit Kolostrum
Die optimale Kälberversorgung ist eine der Grundlagen für einen erfolgreichen landwirtschaftlichen Betrieb. Denn nur die Kälber, die gesund und in einem genau auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Umfeld aufwachsen, entwickeln sich später zu leistungsfähigen Kühen oder Mastbullen. Ein guter Start beginnt für die Kälber schon im Mutterleib und bei der Geburt.
Faktencheck Biokraftstoffe: Verbände betonen die Gesamtbedeutung von Biokraftstoffen für Versorgungssicherheit und Klimaschutz
Die aktuell zum Teil nicht sachgerecht geführte Diskussion über Versorgungssicherheit, Energie- und Lebensmittelpreise nehmen fünf Verbände der Biokraftstoffbranche zum Anlass, mit einem Faktencheck auf den unverzichtbaren Beitrag der Biokraftstoffproduktion für Ernährungssicherheit, Energieversorgung und Klimaschutz hinzuweisen.
Die aktuelle Diskussion über Tierzahlen, Ernährung, Flächenstilllegung etc. wird der drohenden Hungerkrise nicht gerecht, da wir schnell UND in relevanten Größenordnungen eine Entlastung für die Agrarmärkte brauchen,
schreibt der Agrarökonom Prof. Breunig dazu auf Twitter. Der einzige Weg, um dies zu erreichen, wäre eine kurzfristige Vereinbarung zur gemeinsamen Reduktion der Biokraftstofferzeugung in der EU und den USA. Bereits eine Halbierung der Erzeugung könnte zu einer deutlichen Entlastung der Märkte führen.
Aktuelle Studien würden zeigen, dass Biokraftstoffe die Klimaschutzversprechen nicht halten können.
KTBL Praxisheft - Drohnen in der Landwirtschaft
Dank neuester Technik lassen sich Schläge, Pflanzenbestände, ja selbst Einzelpflanzen, aus der Ferne beobachten. Sensoren und Kameras machen für das menschliche Auge sichtbar, was sonst verborgen ist. Aus den Drohnendaten lassen sich wichtige Schlüsse für das Management ziehen. Dabei müssen großen Mengen an erfassten Daten schnell und effektiv verarbeitet werden. In der Publikation des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) erfahren Landwirtinnen und Landwirte sowie potenzielle Dienstleister - auch für Einsteiger gut verständlich - wie landwirtschaftliche Fernerkundung funktioniert und welche Drohnentechnik zur Verfügung steht. Kosten und Flächenleistungen werden genauso beschrieben wie die besonderen rechtlichen Anforderungen.
Gemeinsam nachhaltig ernähren – Kooperative Ernährungssysteme als Treiber der Nachhaltigkeit
Unter dem Titel: Gemeinsam nachhaltig ernähren – Kooperative Ernährungssysteme als Treiber der Nachhaltigkeit
lädt die BLE am 7. April von 13 bis 16 Uhr online unter www.ble-live.de zur dritten großen Veranstaltung im Kontext des Nationalen Dialogs ein. Es werden Beiträg und Diskussionsrunden mit Referierenden aus allen Bereichen entlang der Wertschöpfungsketten stattfinden.