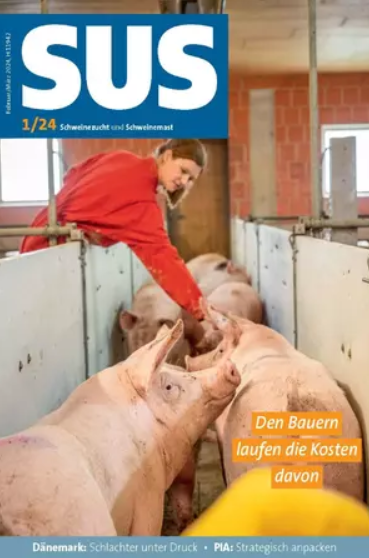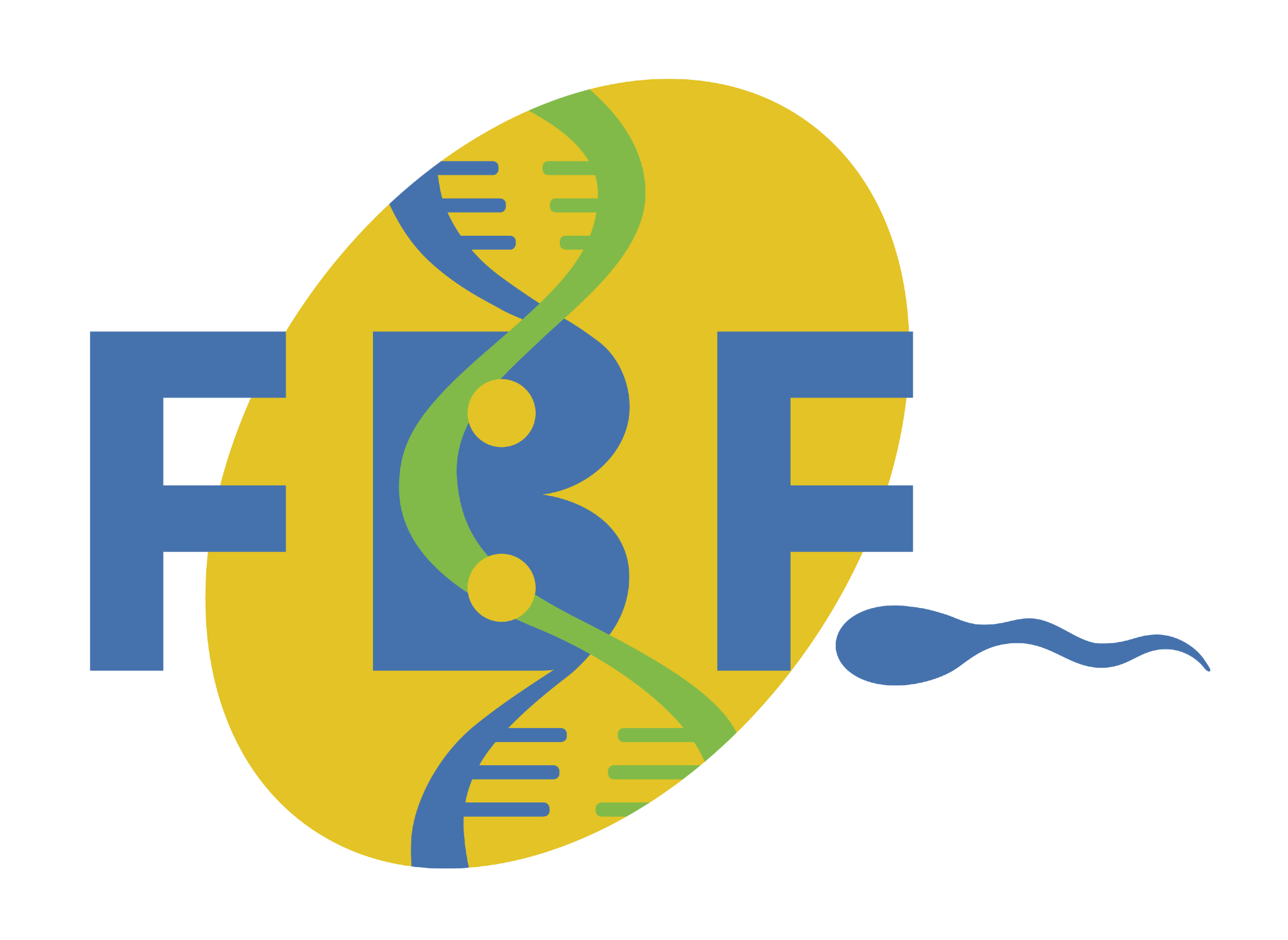BRS News
BayWa CEO Lutz wirft Orbán-Regierung unsolidarisches Verhalten vor
Ein am Sonntag in Ungarn in Kraft getretenes Dekret heizt die Preisspirale an den Agrarmärkten weiter an. Die Orbán-Regierung will so die Futter- und Lebensmittelversorgung in Ungarn sichern, heißt es in einer Pressemeldung des Unternehmens BayWa. Während wir derzeit rund um den Globus eine Welle des Miteinanders und der Hilfsbereitschaft für die Menschen in und aus der Ukraine erleben, fällt die ungarische Regierung zurück in Kleinstaaterei. Die Getreidepreise gehen jetzt schon durch die Decke und werden durch Handelsbeschränkungen wie diese zusätzlich angeheizt. Als EU-Mitglied Milliarden erhalten und sich jetzt so unsolidarisch verhalten, das lässt tief blicken. Das ist ein Bruch des gemeinsamen EU-Binnenmarktes und billiger Populismus im Vorfeld der Wahlen am 3. April
, wird BayWa CEO Prof. Klaus Josef Lutz in der Pressemeldung zitiert.
R+V: Pflege-Vorsorge ist Zukunftsvorsorge
Rund 4,1 Millionen Menschen in Deutschland benötigen aktuell Pflege. Rund 80 Prozent von ihnen, knapp über 3,3 Millionen Menschen, werden in privaten Haushalten betreut, durch Angehörige und ambulante Pflegedienste. Trotz aller Verbesserungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung ist deren Absicherung nicht ausreichend. Noch immer bleiben Versorgungslücken, die schnell ein sehr hohes finanzielles Ausmaß annehmen können. Doch eine private Pflege-Zusatzversicherung haben bisher nur rund 5 Prozent der Bevölkerung abgeschlossen. Hier ist noch viel Luft nach oben
.
ASP: Agrarministerium Brandenburg veröffentlicht aktualisierten Praxisleitfaden zum Fang von Schwarzwild
Im Zuge der Seuchenbekämpfung kommt dem Fang von Schwarzwild in extra dafür konzipierten Fangsystemen eine zentrale Rolle zu. Seit die Afrikanische Schweinepest (ASP) im September 2020 Brandenburg erreicht hat, hat sich eine Vielzahl technischer Neuerungen beim Fallenfang ergeben. Der im Jahr 2018 veröffentlichte Praxisleitfaden zum Fallenfang wurde deshalb aktualisiert und umfangreich erweitert. Fallenbetreibern und Interessierten soll damit ein fundierter Überblick über die verschiedenen Fallentypen und deren tierschutzgerechter Betrieb zur Verfügung gestellt werden.
Zweite Auflage der Pigdays startet

Die virtuelle Veranstaltungsreihe Pigdays von AGRAVIS und Topigs Norsvin geht im März 2022 in die zweite Runde. Bei den Live-Seminaren erläutern Expertinnen und Experten die aktuelle Lage in der Schweinebranche und zeigen, welche Herausforderungen in diesem Jahr auf Tierhalter:innen zukommen und mit welchen Lösungen sie ihren Betrieb zukunftssicher aufstellen. Welche Möglichkeiten stehen tierhaltenden Betrieben zur Verfügung, um das gesetzlich geforderte Angebot an Beschäftigungsmaterial für Schweine zu erfüllen? Wie können die Futtereffizienz verbessert und dadurch die Futterkosten in der Schweineerzeugung gesenkt werden? Welche alternativen Haltungs- und Vermarktungsmöglichkeiten gibt es? Diese und viele weitere Fragen stehen an den vier Live-Seminaren der Pigdays im Fokus. 8. März 2022, 18.30 Uhr: Afrikanische Schweinepest – Was erwartet uns und was können wir tun?; 15. März 2022, 18.30 Uhr: Stroh, Pellets und Co. – Neues zum Thema Beschäftigungsmaterial; 22. März 2022, 18.30 Uhr: Häufig unterschätzt – der Einfluss von Genetik auf Futtereffizienz und Senkung der Futterkosten; 29. März 2022, 18.30 Uhr: Alternative Haltungs- und Vermarktungsmöglichkeiten.
Schweinehalter blicken in weiter ungewisse Zukunft
Enno Garbade, Vorsitzender des Arbeitskreises Sauenhaltung im Landvolk Niedersachsen zeigt angesichts der Ukraine-Krise die bedrückende aktuelle Lage der Schweinehalter auf. Angesichts steigender Anforderungen an Tierwohlstandards, der Seuchenlage aufgrund der Afrikanische Schweinepest oder des Preistief inklusive sinkender Nachfrage nach Schweinefleisch hätten viele Sauenhalter ihre Entscheidung aufgrund der düsteren Aussichten schon getroffen und seien ausgestiegen, so Garbade. 2017 waren wir in Niedersachsen noch 2.100 Sauenhalter, 2022 wird die Zahl wohl unter 1.500 liegen. Wir werden viele weitere Betriebe verlieren", befürchtet Garbade und fordert endlich verbindliche Rahmenbedingungen seitens Politik und Handel. Auch Dr. Albert Hortmann-Scholten von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen stuft die Lage der Schweinebauern und der Futtermittelbetriebe als ernst ein.
SVLFG erläutert neue Sicherheitsvorschriften in der Tierhaltung in zwei neuen Videos
Mit der Novelle der Vorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz Tierhaltung (VSG 4.1) haben sich Änderungen für die Erzeuger ergeben. Mit der Novelle wurden Vorgaben für den Bau und Betrieb von Einrichtungen in der Nutztierhaltung sowie für den Umgang mit Tieren dem Stand der Technik angepasst. In zwei neuen Videos auf dem YouTube-Kanal der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) in der Playlist Sichere Rinderhaltung
stellen SVLFG-Vorstandsmitglied Rudolf Heins und Bettina Hanfstingl als Mitglied im Öffentlichkeitsausschuss die Änderungen und Vorteile der geänderten Vorschriften vor. Heins berichtet zudem über persönliche Erfahrungen aus seinem eigenen Betrieb, in dem er bereits verschiedene Änderungen erfolgreich umgesetzt hat.
DigiSchwein: Auszeichnung der Landwirtschaftskammer als „Digitaler Ort Niedersachsen“
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) ist am 3. März, für das Verbundprojekt DigiSchwein vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung als Digitaler Ort Niedersachsen
geehrt worden. Digital-Staatssekretär Stefan Muhle überreichte die Auszeichnung in der LWK-Versuchsstation für Schweinehaltung in Bad Zwischenahn-Wehnen (Landkreis Ammerland). Die Farmmanagement-Software DigiSchwein soll schweinehaltende Betriebe künftig dabei unterstützen, Veränderungen im Bestand deutlich früher zu erkennen und damit das Wohlbefinden von Sauen, Ferkeln und Mastschweinen nachhaltig zu verbessern.
Desaströse Situation der Schweinehalter: Offener Brief
Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern hat einen offenen Brief an die amtierende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer formuliert, um auf die desaströse Situation der Schweinehalter im Land hinzuweisen. Diese seien mmaßgeblich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Eine Sofortige Wiederaufnahme der Antragsbearbeitung für Corona-Überbrückungshilfen wird gefordert.
Hintergrund: derzeit gibt es in Mecklenburg-Vorpommern einen kompletten Bearbeitungsstopp für diese Hilfen an Schweinehalter. Alle vorherigen Gespräche usw. haben bislang in der Sache zu keinem positiven Ergebnis geführt.
Ost-Ausschuss richtet Task Force für Unternehmen ein
Anliegen und Probleme von Seiten der Unternehmen rund um die Krisenlage in der Ukraine und Russland und das Sanktionsthema schnell zu bearbeiten. Die Task Force koordiniert zudem die Hilfsangebote von Seiten der Wirtschaft für die Menschen in der Ukraine.
Abferkelsysteme im Fokus – Bewegungsbuchten oder freie Abferkelung?!
Die 7. Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) vom Februar 2021 schreibt vor, dass es nur noch eine maximale Fixierungsdauer von 5 Tagen rund um die Geburt in Buchten mit einer Fläche von mindestens 6,5 m2 geben darf. Eine Möglichkeit, um diese Anforderungen zu erfüllen, sind die sogenannten Bewegungsbuchten. Sie besitzen einen Ferkelschutzkorb und bieten den Sauen Bewegungsfreiheit, wenn sie nicht fixiert sind. Dagegen wird die Sau bei der freien Abferkelung
weder vor oder während der Abferkelung noch in der Säugezeit in ihrer Bewegung eingeschränkt (= Freilaufbucht). Eine Möglichkeit zur kurzzeitigen Fixierung der Sau, z. B. zur Behandlung, kann jedoch auch hier vorhanden sein. Das Tierwohl-Kompetenzzentrum Schwein des Netzwerks Fokus Tierwohl befragte im letzten Jahr Ferkelerzeuger zu ihren Praxiserfahrungen mit Bewegungsbuchten oder freier Abferkelung. Die Ergebnisse der Umfrage sollen zusammengefasst und weiteren Landwirten zur Verfügung gestellt werden. In Teil 1 der Befragung wurden nun die Umfrageergebnisse zu den Bewegungsbuchten vorgestellt.