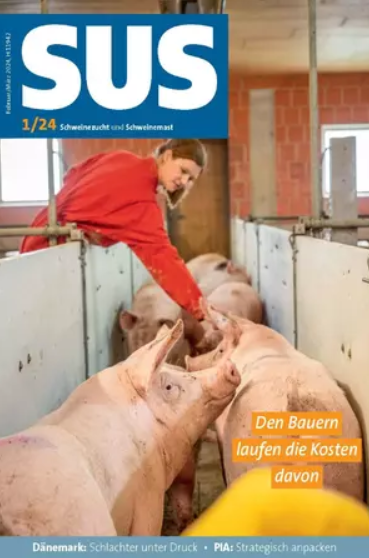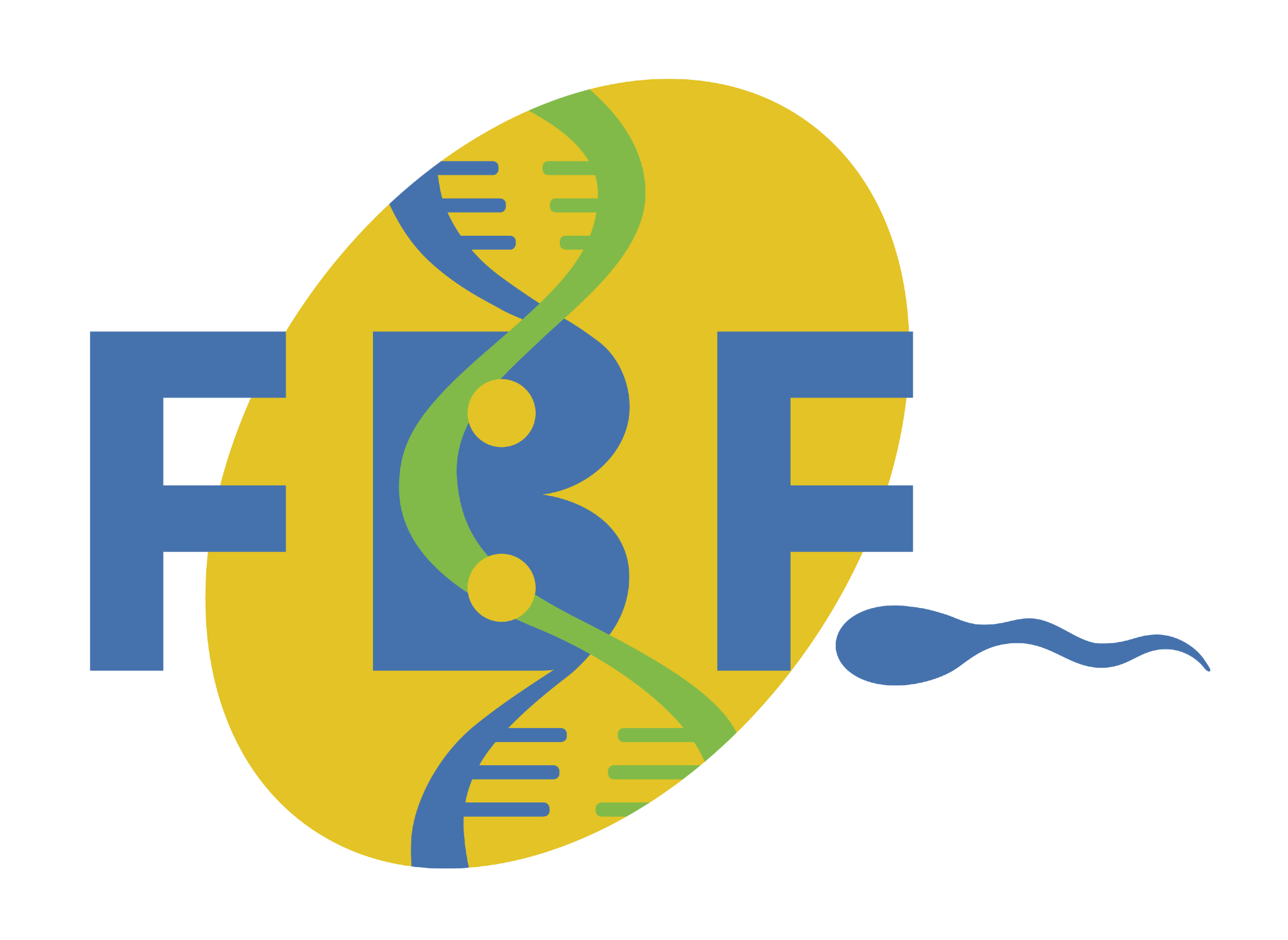BRS News Rind
Ceva: Die 10 besten Fleischrind-Rassen weltweit
Ein neuer Beitrag des Ceva-Blogs ruminant.ceva.pro fasst die zehn besten Rinderrassen weltweit zusammen und hebt ihre Ursprünge, funktionalen Stärken und strategischen Rollen in verantwortungsvollen reinrassigen und Kreuzungsprogrammen hervor, die an verschiedene Umgebungen angepasst sind.
Mecklenburg-Vorpommern - Verlängerung des Pflegezeitraums auf Extensiv genutztem Dauergrünland
Angesichts der aktuellen Wetterlage und der hohen Nachfrage wird aus Gründen der Praktikabilität und zur Entlastung der Zuwendungsempfänger und Behörden eine landesweit in Mecklenburg-Vorpommern geltende Ausnahmegenehmigung im Förderprogramm FP 525 für die extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen per nachfolgender Allgemeinverfügung erteilt: Allgemeinverfügung zur Verlängerung des Pflegezeitraums auf extensiv genutztem Dauergrünland wetterbedingt bis zum 15. März 2026
.
Fachtagung 2026: Umweltverträgliche Landbewirtschaftung in Bremen
Am 9. und 10. April 2026 findet im Dorint City-Hotel Bremen die Fachtagung 2026 – Umweltverträgliche Landbewirtschaftung
statt. Veranstalter ist das Ingenieurbüro Prof. Dr. Oldenburg GmbH. Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus Landwirtschaft, Beratung, Planung und Behörden die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen einer nachhaltigen und umweltverträglichen Landbewirtschaftung auszutauschen.
Digitale Helfer im Milchviehstall: Mehr Tierwohl durch Sensortechnik
Digitale Sensortechnologien gewinnen in der Milchviehhaltung zunehmend an Bedeutung. Moderne Systeme erfassen kontinuierlich Daten zu Aktivität, Wiederkauverhalten, Körpertemperatur oder Fressverhalten der Tiere und ermöglichen so eine frühzeitige Erkennung von Gesundheits- und Fruchtbarkeitsproblemen. Dadurch lassen sich Tierwohl, Arbeitsabläufe und Betriebsmanagement gleichzeitig verbessern.
EU-Diskussion über Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen
Wie in einem aktuellen LinkedIn-Beitrag aus dem europäischen Agrarumfeld berichtet wird, rückt die Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen zunehmend in den Mittelpunkt politischer Diskussionen. Hintergrund sind anhaltende wirtschaftliche Herausforderungen vieler Betriebe, die durch steigende Produktionskosten, Marktschwankungen und strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft geprägt sind.
Bioenergie: Bedeutung moderner Biogasaufbereitungsanlagen wächst
Wie in einem aktuellen LinkedIn-Beitrag aus der Bioenergiebranche berichtet wird, gewinnt die Weiterentwicklung von Biogas- und Biogasaufbereitungsanlagen zunehmend an Bedeutung für die Energieversorgung. Moderne Anlagen ermöglichen es, Rohbiogas zu Biomethan aufzubereiten und anschließend flexibel in das Erdgasnetz einzuspeisen oder in verschiedenen Energieanwendungen zu nutzen.
Forschungsförderung stärkt Zukunftsprojekte in Niedersachsen
Wie in einem aktuellen LinkedIn-Beitrag aus dem Umfeld des Programms Zukunft.Niedersachsen
mitgeteilt wird, erhalten neue Forschungs- und Innovationsvorhaben zusätzliche Unterstützung, um zentrale Zukunftsthemen in Wissenschaft und Praxis voranzubringen. Ziel der Förderung ist es, innovative Projekte schneller in die Anwendung zu bringen und die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Praxis weiter zu stärken.
Milchgipfel: Branche diskutiert Marktstabilisierung und politische Maßnahmen
Wie der Milchindustrie-Verband mitteilt, standen beim jüngsten Milchgipfel mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer die aktuelle Entwicklung auf den internationalen Milchmärkten sowie mögliche Maßnahmen zur Stabilisierung der Branche im Mittelpunkt der Gespräche. Vertreter aus Landwirtschaft, Molkereiwirtschaft und Lebensmittelhandel tauschten sich insbesondere über die weltweit steigende Milchproduktion und deren Auswirkungen auf die Preisentwicklung aus.
Agri-Photovoltaik: Studie zeigt wirtschaftliche Herausforderungen
Agri-Photovoltaik (Agri-PV), also die kombinierte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für Pflanzenbau und Stromerzeugung, gilt als möglicher Lösungsansatz für Flächennutzungskonflikte in der Energiewende. Das Thünen-Institut hat über LinkedIn aktuelle Informationen zu einer Untersuchung veröffentlicht, die zeigt, dass entsprechende Anlagen derzeit häufig höhere Kosten verursachen als klassische Freiflächen-Photovoltaikanlagen.
Aufruf zur Weiterverbreitung von Fachinformationen zur Tierhaltung
Aktuelle fachliche Informationen und Stellenausschreibungen aus Forschung und Praxis werden zunehmend über digitale Netzwerke verbreitet, um möglichst viele Fachleute aus Landwirtschaft, Tiermedizin und Wissenschaft zu erreichen. Auch in einem aktuellen Beitrag weist Prof. Dr. Nicole Kemper von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover auf neue Informationen und Veröffentlichungen aus ihrem Fachbereich hin und ruft dazu auf, diese in der Fachcommunity weiterzugeben.











 Tagung 2026
Tagung 2026